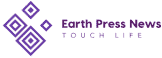„Faith-based“ ist eine Filmqualifikation, die mit viel Gepäck einhergeht. Da dieses aufkeimende Subgenre das umfasst, was wohlwollend als vereinfachtes Geschichtenerzählen bezeichnet werden könnte, riskieren seine Beiträge, Kritiker dazu zu verleiten, auf einer Kurve zu bewerten. Andererseits fördern die Themen und die innere Überzeugung dieser Filme eine gewisse reflexartige Ablehnung und Gruppendenken, was die vermeintliche Aufgeschlossenheit der Kritiker und ihre Fähigkeit, diesen Werken dort zu begegnen, wo sie existieren, in Frage stellt.
Pater Stu ist das neuste glaubensbasierte Großleinwandangebot, aber, erzählt mit Sensibilität, Ernsthaftigkeit und einer nicht geringen Portion hinterlistigem, schurkischem Charme, ist es in erster Linie eine sichere Übereinstimmung von Stoff und den Stärken eines Filmstars. Mit Mark Wahlberg als Boxer, der zum Priester wurde, fühlt sich dieses auf einer wahren Geschichte basierende Drama vollständig gelebt an, teilweise (wenn auch nicht ausschließlich), weil es die Anziehungskraft der Arbeiterklasse seiner Hauptrolle so geschickt nutzt .
Die Geschichte dreht sich um Stuart Long, einen Amateur-Boxergesellen in Montana, dessen Familie noch Jahrzehnte später im Schatten des Verlustes lebt. Der Tod seines älteren Bruders im Alter von nur sechs Jahren zerriss die Ehe seiner Eltern Kathleen (Jacki Weaver) und Bill (Mel Gibson) und ließ Stuart von letzterem entfremdet zurück. Da die Berufsaussichten scheinbar versiegen, zieht Stuart impulsiv nach Hollywood, wo sein Vater jetzt lebt, mit dem Traum, Schauspieler zu werden.
Als ihm die religiös fromme Carmen (Teresa Ruiz) auffällt, spürt Stuart sie in ihrer Kirche auf. Dort fühlt er sich berufen, ein besserer Mann zu werden, und beginnt, sich aus dem Vorspielzirkel zurückzuziehen, weniger mit seinen Fäusten zu reden und seine Spiritualität zu pflegen. Nach einem dramatischen Motorradunfall beschließt er sogar, Priester zu werden. Schließlich wird Stuart mit einer unheilbaren, fortschreitend degenerativen Muskelerkrankung, der Einschlusskörpermyositis, diagnostiziert und muss sich mit dem auseinandersetzen, was er als Gottes Plan für ihn und seine Auswirkungen auf seine Lieben ansieht.
Pater Stu ist kein zynisches Spiel um demografische Marktanteile. Sobald es seinen Charakter an einem Ort der Hingabe und Akzeptanz landet, ist es angemessen, absolut aufrichtig über Stuarts Glauben. Es verschmilzt seine Religiosität jedoch auch mit einer gewissen Art von schroffem Individualismus, in dem einfache Hartnäckigkeit als Attribut verherrlicht und von übergroßer Tugend durchdrungen ist. Dies ist, um fair zu sein, ein legitimes Persönlichkeitsmerkmal, das sich in allem widerspiegelt, von Stuarts Streben nach dem Priesterseminar bis zu seiner Beharrlichkeit, Carmen zu umwerben.
Aber genau hier könnte sich bei manchen ein wenig Unbehagen einschleichen. Dieser Ansatz wird so oft für eine „von-den-eigenen-Bootstraps“-Mentalität missinterpretiert und/oder mit ihr in Verbindung gebracht (von Schöpfern und Zuschauern gleichermaßen). Dies wird wiederum verwendet, um eine Vision des Christentums zu rechtfertigen, in der alles von Armut bis Krankheit etwas ist, das persönlich überwunden werden muss, unter Verzicht auf jede gemeinsame soziale Verantwortung – oder sogar die Chance, das Leben dieser Menschen zu verbessern außerhalb unserer engsten Familie und Freunde. Um klar zu sein, das ist nicht was Pater Stu verkauft in erster Linie. Dies wird aber auch nicht ausdrücklich abgelehnt und lässt den Film offen für eine blinde Interpretation.
Diese Besorgnis wird jedoch sowohl durch die Handwerkskunst des Films als auch durch seine Schauspielerei gemildert. Schon früh zieht Wahlberg (auch ein sehr aktiver Produzent des Projekts) bekannte Hebel von schroffem, respektlosem Ehrgeiz. Aber die Qualität seiner Leistung und der schlichte Charme des Films werden schließlich deutlicher. Sie sind am meisten erleichtert in zwei gut gehaltenen Predigten, in letzterer, in der ein kranker, zurückhaltender Stuart die Vorteile des Leidens als die ultimative Chance, Christus nahe zu sein, preist. Ruiz (Narcos: Mexiko) gibt auch eine sehr gute Wendung und haucht einer Rolle tiefes Gefühl ein, die in weitaus geringeren Händen als eine schwache Variation des Archetyps der „guten katholischen Latina“ hätte ausgelegt werden können.
In ihrem Spielfilmdebüt liefert Autorin und Regisseurin Rosalind Ross (seit 2014 Gibsons Partnerin im wirklichen Leben) ein sympathisches Werk lässiger Missionierung ab. Insbesondere ihr Drehbuch greift Charakterdetails mit einer luftigen Ökonomie auf; Stuart zum Beispiel, der glücklich eine winzige Station im Leben aufsteigt, wird in einer Montage festgehalten, in der er in einer unmöblierten Wohnung kocht und dann Steak aus einer Bratpfanne isst.
Ross fertigt auch zwei zusammengesetzte Nebencharaktere an – in den Mitverehrern Ham (Aaron Moten) und Jacob (Cody Fern) – die dazu dienen, die Unterstützung und den Rückschlag auf Stuarts gewählten Weg widerzuspiegeln; jeder ist schön ausgearbeitet, und insbesondere Jacob erhält einen eigenen, etwas bewegenden Bogen. Am wichtigsten ist jedoch, dass Ross die Stimme ihres Stars ziemlich gut kennt und Szenen und Dialoge kreiert, die sich in sein Offscreen-Image als offener Jedermann einfügen, der immer noch ein erhebliches Gewicht aus einer schwierigen Jugend mit sich herumträgt.
Solide, nicht auffällige Arbeit von Produktionsdesigner David Meyer unterstützt die Arbeiter-Sensibilität des Films. Inzwischen gibt es eine gut kuratierte Auswahl an Songs von unter anderem Glen Campbell, Loretta Lynn, Waylon Jennings und Conway Twitty Pater Stu ein weiteres verwurzeltes Charaktergefühl, auch wenn seine Partitur von Komponist Dickon Hinchliffe Trauer mit der ganzen Souveränität einer anonymen, hastig gegriffenen Kondolenzkarte ausdrückt.
Letzten Endes, Pater Stu lokalisiert oder erhebt nicht unbedingt irgendwelche Tiefen über den religiösen Glauben. Aber auch für diese reicht es nicht wirklich hart und hoch. Stattdessen befasst sich der Film einfach damit, die Geschichte der Reise eines Mannes und ihrer Auswirkungen auf die Menschen um ihn herum, seine Familie und seine Gemeinschaft zu erzählen. Destilliert ist es ein ziemlich gut skizziertes Porträt der Selbstfürsorge – spirituell, ja, aber auch psychologisch und physisch – und der nach außen hin kräuselnden Wirkungen der Heilung, die sich aus dieser einzigen Wahl ergeben können.