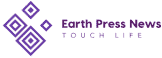Auf meinem Lieblingsfoto von Charley blickt sie mit ehrfürchtigen Augen in die Ferne, allein zwischen den bonbonfarbenen Bannern eines verlassenen Times Square. Es wurde im Sommer 2020 aufgenommen, als die belebtesten Straßen New Yorks unheimlich leer waren. Man könnte meinen, dass Charley die Apokalypse überlebt hatte und dass sie – ihre Ohren selbstbewusst zurückgelegt – bereit war, sich allen Herausforderungen zu stellen, die damit einhergehen, der letzte Beagle auf Erden zu sein. Sie scheint dem Betrachter knapp über die Schulter zu schauen; Der Fotograf – mein Ex-Freund – muss auf dem Bürgersteig gehockt haben, um sie auf Augenhöhe einzufangen. Das Foto gefiel mir so gut, dass ich es ausdrucken und rahmen ließ.
Auf meinem Foto von Charley, das mir am wenigsten gefällt – aufgenommen anderthalb Jahre später, bevor ich unsere Wohnung zum letzten Mal verließ – sind ihre Augen niedergeschlagen; Ihr Schwanz hängt herab. Die Hälfte ihres Körpers ist im Schatten verborgen. Ihre Ohren sind nach vorne über ihr Gesicht geschoben, wie eine nervöse Mittelschülerin, die versucht, sich hinter ihren Haaren zu verstecken. Das Fell an den Rändern ihrer Ohren ist von Kastanienbraun zu Weiß verblasst. Sie sieht betrogen aus. Sie sieht vorwurfsvoll aus. Sie sieht deprimiert aus.
Oder vielleicht hatte sie Hunger. Projiziere ich meine eigenen Gefühle auf ein Tier, dessen sehnsüchtiger Blick genauso gut auf den entkommenen Hühnerknochen hätte zurückzuführen sein können? Wie sehr überlagern wir unsere komplizierten menschlichen Emotionen den Bildern von Hunden?
Über diese Fragen habe ich bei der Wallace Collection nachgedacht neue Ausstellung „Porträts von Hunden: Von Gainsborough bis Hockney“ in London (wo ich jetzt lebe), als ich Bilder eines als Richter verkleideten Pudels und eines Spielzeug-Havanesers mit einer rosa Schleife im Fell und einem schuldbewussten Gesichtsausdruck betrachtete Gesicht, „als suche er um Vergebung“ (so der Wandtext) neben einem zerkauten Schuh.
Oberflächlich betrachtet die Show, die Kuriositäten wie eine mit Rubinen besetzte Fabergé-Nachbildung (Leihgabe Seiner Majestät) eines königlichen Lieblingshundes zeigt; eine halberotische Statue aus dem 1. Jahrhundert, die einen Windhund zeigt, der am Ohr seines Gefährten knabbert; und eine Studie einer Pfote von Leonardo da Vinci – ist als charmante Abwechslung gedacht, als Hommage an die besondere Bindung des Menschen zu seinen hündischen Begleitern. Der Abendstandard beschrieben es als „sehr lustig“, wenn auch etwas verschroben Wächter Rezensent (eindeutig ein Katzenmensch) beschwerte sich dass die Sammlung den Hundeeltern zugute kam. „Um diese Ausstellung zu lieben“, schrieb er, „muss man … einen Hund besitzen.“
Ich bin nicht einverstanden. Ich – nur ein ehemaliger Stiefelternteil eines Hundes – war begeistert. Und nicht, wie die Wächter vorgeschlagen, aus dem blöden Vergnügen heraus, einen Terrier aus dem 19. Jahrhundert in einer schottischen Haube zu sehen.
Als ich voller Trauer den Raum erreichte, wusste ich, dass ich bleiben würde, bis das Museum schloss. Es half mir, mich mit einer Frage auseinanderzusetzen, mit der ich seit Monaten zu kämpfen hatte: War es verrückt, um einen Hund zu trauern, der noch lebte? Ein Hund, der – den Strava-Standorten meiner Ex nach zu urteilen – bis vor kurzem nur ein paar Meilen entfernt gelebt hatte?

„Portraits of Dogs“ zeugt von der ergreifenden, kreativen und manchmal verstörenden Art und Weise, wie wir Hunde betrauert haben, von der Tierpräparation bis zur modernen Kunst. Ich sah die ausgestopften Überreste eines Malteser-Terriers namens Minna, die seit 1883 in einem kunstvollen Schrank neben Radierungen von Burgen und Blumen ruhen. Ich habe Lord Byrons lyrisches Epitaph für seinen geliebten Neufundländer Boatswain gelesen. Tage später verfolgt mich noch immer Lucian Freuds Gemälde des Grabsteins seines verstorbenen Whippet – der Name des Hundes (Pluto) in kindlichen Druckbuchstaben eingraviert, die irgendwie frisch geschnitzt und bereits verblasst wirken. Ich sah komplizierte viktorianische Broschen, die mit Porträts von Hundegesichtern und Haarsträhnen verziert waren.
Ich verstehe den Impuls, das Fell eines Hundes zu schützen. Als ich mit Charley zusammenlebte, war ihr ständiger Haarausfall eine Quelle der Verärgerung. Ihre Haare neigten dazu, den Staubsauger zu verstopfen und sich in den Nähten meiner Pullover festzusetzen (wo sie unweigerlich bis zu einem entscheidenden Moment unentdeckt blieben). Als ich mich endlich dazu durchringen konnte, den Koffer auszupacken, den ich mir auf dem Weg nach draußen geschnappt hatte, flog ein Wirbel von Charley-Haaren heraus. Ich sammelte meine Kleidung ein und stopfte sie zurück in meine Tasche.
Meine Trauer war kompliziert: In den Monaten nach meiner Trennung trauerte ich nicht nur um Charleys Abwesenheit in meinem Leben. Ich machte mir auch Sorgen wegen meiner Abwesenheit bei ihr. Ich habe ihre Auftritte auf dem Instagram-Account meiner Ex unter die Lupe genommen: Wurde ihr Fell schneller grau als zuvor? Sah sie traurig aus? (Beagles sehen mit ihren traurigen Augen und hängenden Ohren fast immer traurig aus.) Wonach habe ich überhaupt gesucht? Habe ich auf Anzeichen dafür gehofft, dass sie mich vermisst? Oder wollte ich eine Bestätigung, dass es ihr gut ging?
Ich war kaum allein, wie ich in der Wallace Collection erfuhr, als ich mich fragte, wie es meinem Hund ohne mich ergehen würde. In einem melodramatischen Gemälde mit dem Titel „Der Haupttrauernde des alten Hirten“ wirft sich ein trauernder Collie auf den Sarg seines Herrchens. Nach dem Tod von König Edward VII. im Jahr 1910 – und hinterließ seinen Lieblingshund Caesar – erschien ein beliebtes Geschichtenbuch mit dem Titel Wo ist Meister, Caesar zugeschrieben, wurde veröffentlicht.
Als ich nach Hause kam, schaute ich nach das Buch online gestellt und war froh, dass es gemeinfrei ist. Ich las von Caesar, der durch die Palasthallen streifte, nach Edward suchte und sich daran erinnerte, dass nur der König wusste, wie man ihn am Kinn kitzelte. „Wo ist der Meister?“ jammert der untröstliche Terrier. „Ich bin seit Tagen überall auf der Suche nach ihm.“ Als ihm schließlich klar wird, dass Edward nicht mehr da ist, kippt seine Trauer in Selbstmordgedanken. „Ich kann den Meister nirgendwo finden und ich bin so einsam … Ich wünschte so sehr, dass ich auch sterben könnte.“
Das Lesen dieser krankhaften, selbstschmeichelnden Überlegungen brachte mich zu meiner ursprünglichen Frage zurück: Projizieren wir zu viel auf unsere Haustiere? Wahrscheinlich. Aber wer kann widerstehen? Wo ist der Meister? verkauft 100.000 Kopien.
Es ist über ein Jahr her, seit ich Charley das letzte Mal gesehen habe. Ich habe nicht um das Sorgerecht gekämpft, weil sie meine Ex-Freundin war, bevor sie mir gehörte, und weil es mir verrückt vorkommt, einen Hund mit der Ex-Freundin zu teilen – so häufig das auch sein mag. Wenn mir beim Kochen ein Krümel Essen herunterfällt, höre ich nicht mehr auf das Klappern meiner Pfoten; Ich räume es selbst auf.
Manchmal sehe ich Charley in meinen Träumen. In einem fällt mir plötzlich ein, dass sie seit Wochen nichts zu essen bekommen hat; Ich renne zu der Stelle, wo ihr Trockenfutter sein sollte, finde aber nur ein Glas Twizzlers. In einem anderen Fall entdecke ich, dass der Hund, von dem ich dachte, er sei Charley, in Wirklichkeit ein Betrüger ist: „Charlay“.
Nach der Trennung schickte mir mein Ex das gerahmte Foto von Times Square Charley zurück. Ich wollte es nicht ansehen, konnte mich aber nicht dazu durchringen, es wegzuwerfen. Jetzt lebt es im Keller meines Vaters, zusammen mit einigen alten Büchern und Klamotten.
So viele Bilder in der Wallace Collection feiern die Treue der Hunde zu uns – ihren Wunsch, uns mit ihren Jagdkünsten, ihren Tricks oder einfach nur ihrer ständigen Gesellschaft zu erfreuen. Vielleicht liegt es daran, dass wir ihre Treue und Abhängigkeit fetischisieren, weshalb ich so starke Schuldgefühle hatte, weil ich Charley verlassen habe.
Ein drittes Foto von Charley: August 2020. Ich kannte sie erst seit ein paar Monaten; Ich war gerade dabei, mich zu verlieben. Ich beuge mich auf der Couch über sie und umarme sie. Unsere Nasen sind fast zusammengepresst. Es ist kein besonders schmeichelhaftes Foto von mir – meine Haare sind kraus, meine Augen sind geschlossen; Mein BH-Träger ist zu sehen, und zwar nicht auf eine sexy Art und Weise – aber ich habe ihn zu meinem Hinge-Profil nach der Trennung hinzugefügt.
War das ein Akt der Selbstsabotage? („Ist das dein Hund?“ „Nein, der von meinem Ex“ war ein bisschen ein Gesprächskiller.) Ein sinnloser Beweis der Loyalität? Als meine Trauer ihren Höhepunkt erreichte, las sich mein Profil wie eine Hommage an Charley. Als eines meiner Hauptinteressen habe ich „mittelgroße Hunde“ aufgeführt. Irgendwann zeigte mir der Algorithmus nur Bilder von Männern mit Hunden.
Ich muss es irgendwann abgeschwächt haben, denn mein neuer Freund ist kein Hundemensch. Zumindest war er es nicht, als wir uns trafen. Nachdem ich ihn zu CitiPups geschleppt und beobachtet habe, wie er sich langsam mit einer französischen Bulldogge verbindet, habe ich Hoffnung.